„Notfallpatient GKV“ – Bundesausschuss diskutierte mögliche Bürgerversicherung
25.9.2025 – Auf Antrag der Partei Die Linke beantworteten am Mittwoch Experten im Gesundheitsausschuss des Bundestages Fragen zu einer möglichen Reform des Gesundheitssystems. Auch wenn die Vorschläge weit auseinanderlagen, so zeigte sich: Es herrscht dringender Handlungsbedarf für eine grundlegende Strukturreform.
Im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages fand am Mittwoch eine Anhörung zu dem Thema „Leistungskürzungen und Beitragsexplosion in Gesundheit und Pflege verhindern – Jetzt gerechte Finanzierung einführen“ statt. Beantragt hatte die Anhörung die Bundestagsfraktion Die Linke.
In der BT-Drucksache 21/344 (PDF, 174 KB) macht die Partei auf die Finanzkrise in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der sozialen Pflegeversicherung (SPV) aufmerksam.
Notfallpatient gesetzliche Krankenversicherung?

- Nina Warken (Bild: Tobias Koch)
Laut den Linken sei der durchschnittliche Zusatzbeitrag in den letzten Monaten stark gestiegen. Statt der erwarteten 2,5 Prozent sogar auf 2,9 Prozent des Bruttolohns, wie eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. zeige. Im Jahr zuvor lag er noch bei 1,7 Prozent.
Trotzdem seien die Kassen finanziell am Limit. Der Bund musste im Mai 2025 bereits 800 Millionen Euro Bundeszuschuss vorziehen, weil die gesetzliche Liquiditätsreserve unterschritten wurde. Gesundheitsministerin Nina Warken selbst spreche von der GKV als „Notfallpatient“ und warne vor erneuten Beitragserhöhungen.
Auch die soziale Pflegeversicherung sei defizitär: Eine Kasse habe bereits durch andere gestützt werden müssen (VersicherungsJournal Medienspiegel 12.3.2025).
Die Linke fordert sofortige Strukturreformen
Statt kurzfristiger Finanzspritzen fordert die Linke in ihrem Antrag sofortige und umfassende Strukturreformen, die per Gesetzentwurf umgesetzt werden sollen.
Die Bundesregierung, so der Vorwurf, schiebe dringend nötige Reformen auf die lange Bank, indem sie das Thema an eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe (27.6.2025) überweise – obwohl die nötigen Maßnahmen aus Sicht der Linken längst bekannt seien:
- Die Beitragsbemessungsgrenze (8.9.2025) in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung soll sofort auf 15.000 Euro monatlich angehoben werden, mit dem langfristigen Ziel, sie ganz abzuschaffen.
- Auch die Versicherungspflichtgrenze soll entsprechend angehoben und perspektivisch abgeschafft werden – vorausgesetzt, Privatversicherte werden in das Solidarsystem überführt. So würden mehr Gutverdienende zur Finanzierung der Kranken- und Pflegekassen beitragen.
- Der Bund soll für Bürgergeld-Empfänger höhere Beiträge an die Krankenkassen zahlen – so, als ob diese ein Bruttoeinkommen von rund 1.500 Euro hätten. Hintergrund ist, dass nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes derzeit rund zehn Milliarden Euro pro Jahr fehlen, um die Gesundheitskosten für Bürgergeldbezieher vollständig aus Steuermitteln zu decken. Mit der Reform würden die Sozialkassen entlastet und die Finanzierung gerechter verteilt.
- Auf apothekenpflichtige Arzneimittel soll künftig nur der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent erhoben werden statt wie bisher 19 Prozent.
- Der Bundeszuschuss soll künftig automatisch steigen, wenn die Ausgaben der Krankenkassen wachsen – damit die Finanzierung Schritt hält und Beitragserhöhungen vermieden werden.
Hat zweigeteilte Pflegeversicherung ein Gerechtigkeitsproblem?
In der Fragerunde des Gesundheitsausschusses erläuterte zunächst Professor Dr. Heinz Rothgang, Leiter der Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung im Socium Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen, worin nach seiner Ansicht das grundsätzliche Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung besteht.
Demnach habe das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001 festgestellt, dass eine ausgewogene und gerechte Lastenverteilung zwischen der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflegepflichtversicherung Voraussetzung für die Verfassungsmäßigkeit des zweigeteilten Systems sei.
Davon könne aber beim derzeitigen Status quo keine Rede sein. So seien die Ausgaben für einen Sozialversicherten im Durchschnitt doppelt so hoch wie für einen Privatversicherten.
„Zusammenführung normativ und verfassungsrechtlich geboten“
Grund dafür seien unter anderem eine günstigere Altersstruktur der Versicherten sowie Selektionseffekte – zum Beispiel der Ausschluss von Personen mit Vorerkrankungen außerhalb des Basistarifs. Auch hätten die Privatversicherten ein durchschnittlich 50 Prozent höheres Einkommen.
Demgemäß hält Rothgang „eine Zusammenführung der Systeme normativ und verfassungsrechtlich geboten“. Eine solche Reform könnte gesetzlich Pflegeversicherte um etwa 0,3 Beitragspunkte entlasten.
Eine Bürgerversicherung wäre ein ganz falsches Signal.
Professor Dr. Thomas Schlegel, Kanzlei für Gesundheitsrecht
Bürgerversicherung hätte negative Auswirkungen für Leistungserbringer
Dem entgegen positionierte sich Professor Dr. Thomas Schlegel, Kanzlei für Gesundheitsrecht Professor Schlegel, Hohmann, Diarra & Partner, dass eine Zusammenführung von PKV und GKV zu einer Bürgerversicherung negative Auswirkungen sowohl für die Investitionsbereitschaft ins Gesundheitssystem als auch für Leistungserbringer hätte.
Demnach könnten Ärzten und Heilerbringern etwa ein Viertel der derzeitigen Einnahmen wegbrechen, wie Schlegel auf Nachfrage eines CDU-Abgeordneten erläuterte. Damit würde auch die Attraktivität sinken, einen Gesundheitsberuf zu ergreifen – bei ohnehin bestehendem Fachkräftemangel im Gesundheitssystem.
Eine Bürgerversicherung „wäre ein ganz falsches Signal an den Leistungserbringer“, so der Fachanwalt. Sie hätte Auswirkungen auf die Innovationsfreudigkeit und -fähigkeit des Gesundheitssystems – und hätte somit negative Effekte für alle Versicherten.
Dringend Reformen auf der Ausgabenseite notwendig
Dr. Richard Ochmann von der Iges Institut GmbH wurde gefragt, wie den steigenden Beiträgen in der Sozialversicherung allgemein entgegengewirkt werden könne. Das Institut hatte gewarnt, dass die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung bis 2035 von derzeit etwa 17,5 Prozent auf dann 20 Prozent steigen könnten, in der sozialen Pflegeversicherung von derzeit 3,8 Prozent auf dann fünf Prozent (22.1.2025, 7.2.2025).
Die Sozialversicherungsquote, also der Anteil der Sozialabgaben am Bruttoeinkommen, könne bei mittlerer Lohnentwicklung bis 2035 auf 50 Prozent steigen, warnte Ochmann. Und die Ausgaben in der Kranken- und Pflegeversicherung würden seit spätestens 2019 stärker anwachsen als die Einnahmen.
Im Gegensatz zur Linken sieht er dementsprechend Reformbedarf vor allem auf der Ausgabenseite. Einmalige Umverteilungsmaßnahmen, etwa höhere Beiträge des Bundes für Pflegeversicherte, würden dagegen nur kurzfristige Effekte zeigen – und zu ähnlichen Ausgabensteigerungen wie zuvor führen.
Strukturen der Gesundheitsversorgung müssen angepasst werden
Ochmann betonte, dass die Strukturreformen langfristig sinnvoller seien. Insbesondere sollten die grundlegenden Strukturen der Gesundheitsversorgung angepasst werden. Dazu zählten etwa die Krankenhaus- und Notfallreform, die bereits durch die Ampelregierung angestoßen wurde, sowie Maßnahmen zur Lenkung der Patienten zum Hausarzt, um die Kostenentwicklung nachhaltiger zu steuern.
Keine Lösung sieht der Gesundheitsökonom hingegen darin, dass zukünftig auch Sozialbeiträge auf Kapitaleinkünfte gezahlt werden müssten, etwa aus Aktien. Auch dies hatte die Linke bereits gefordert. Da müsste die Beitragsbemessungsgrenze erheblich angehoben werden, um überhaupt merkbare Effekte zu erzielen.
Selbstbeteiligung für Kassenpatienten wie in den Niederlanden?
Ebenfalls auf Reformen bei den Ausgaben zielten die Erläuterungen von Professor Dr. Christian Karagiannidis ab, Leitender Oberarzt und Professor am Lehrstuhl für Pneumologie an der Universität Witten/Herdecke.
Der Mediziner warnte ebenfalls, dass es negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt habe, wenn man einfach die Beiträge der Krankenkassenbeiträge für Gutverdiener erhöhe. Schon jetzt würden sich die Gesundheitsausgaben auf 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts belaufen – bei steigender Tendenz.
Stattdessen schlug er vor, eine Eigenbeteiligung in der GKV einzuführen, da diese zu merklichen Steuerungseffekten und mehr Effizienz führe. Als Vorbild nannte er das niederländische Gesundheitssystem, bei dem Versicherte zunächst 385 Euro Selbstbeteiligung pro Jahr zahlen müssten, bevor die Krankenversicherung einspringe. Auf diese Weise könne man überflüssige Bagatellfälle in den Arztpraxen und Notaufnahmen deutlich reduzieren.
Eine solche Reform müsse sozialverträglich gestaltet sein, damit nicht Menschen mit niedrigen Einkommen notwendige Arztbesuche aufschieben, so der Mediziner. Er bemängelte, dass die Gesundheitskompetenz der Bürger immer geringer werde – und zu viele Menschen zeitig zum Arzt gehen würden.
Die gleichen Leistungen mit weniger Input erbringen
Ein Ausgabenproblem im Gesundheitssystem sieht auch Professor Dr. Simon Reif, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Volkswirtschaftler und Gesundheitsökonom hob hervor, dass im Gesundheitssystem noch erhebliche Effizienzreserven geschöpft werden könnten.
Dabei hob er vor allem auf die überbordende Bürokratie ab. Schon jetzt würden Ärzte, Pfleger und Gesundheitsdienstleister bis zu einem Drittel ihrer Arbeitszeit damit verbringen, Behandlungen zu dokumentieren und zu organisieren – dies zeige, dass hier Potenzial liege, die vorhandenen Ressourcen besser auszuschöpfen.
Statt vieler sehr häufiger und sehr kurzer Arztbesuche, wie Reif sie derzeit im Gesundheitssystem beobachtet, sei es zudem sinnvoll, Patienten derart zu lenken, dass sie weniger häufig zum Arzt gehen – aber sich der Arzt länger um sie kümmere. Auch bei unnötigen Krankenhausfällen gebe es noch Einsparpotenzial, etwa durch vermehrte ambulante und kostengünstigere Behandlungen.
Reformideen liegen eigentlich auf dem Tisch
Antje Kapinsky vom Verband der Ersatzkassen e.V. (VDEK) wurde von einer Grünen-Politikerin gefragt, ob die Antworten für eine wirksame Gesundheitsreform nicht eigentlich bereits auf dem Tisch liegen – und die Expertenkommission der Bundesregierung folglich unnötig sei. Könnte man nicht direkt mit einer Gesundheitsreform loslegen?
Dies bejahte Kapinsky indirekt. Sie verwies auf die Krankenhausreform sowie weitere Reformen zur Leistungs- und Qualitätssteuerung, die die Vorgängerregierung unter Professor Dr. Karl Lauterbach angestoßen hatte, aber nicht mehr umsetzen konnte.
Auch solle ein neuer Herstellerrabatt auf Medikamente angestrebt werden, riet die Kassenfunktionärin. Der vorherige Rabatt, derzeit nicht mehr gültig, habe sofort 1,3 Milliarden Euro an Einsparungen für die Krankenkassen gebracht. Zudem schloss sie sich der Forderung an, dass die Mehrwertsteuer auf Medikamente von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt werde.
Leserbriefe zum Artikel:
Frank Janssen - Die Bürgerversicherung hilft nicht wirklich weiter . mehr ...
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.










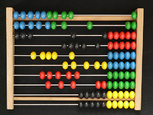



.jpg)




