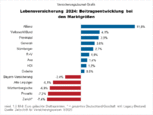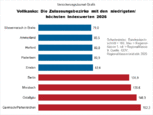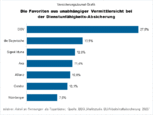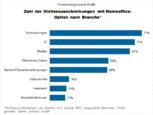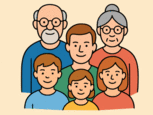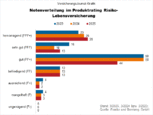Gesetzliche Erbfolge: Wer ohne vorhandenes Testament erbt
2.9.2025 – Die gesetzliche Erbfolge regelt, wer das Vermögen eines Verstorbenen erhält, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt. Die Details sind unter anderem für Versicherungskunden wichtig, damit sie ihren Nachlass verantwortungsvoll planen können, um zum Beispiel spätere Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden, aber auch die Absicherung von Angehörigen klar zu regeln.
Wenn für eine Person kein gültiges Testament oder kein Erbvertrag vorliegt, greift nach deren Ableben die gesetzliche Erbfolge gemäß §§ 1922 und folgende BGB. Berücksichtigt werden hierbei nur der Ehepartner und Blutsverwandte des Erblassers. Erben kann zudem nur, wer zum Todeszeitpunkt des Erblassers noch lebte oder bereits gezeugt, aber noch nicht geboren war.
Daher sind beispielsweise angeheiratete Angehörige wie ein Stiefkind, eine Stiefmutter oder ein Schwager laut gesetzlicher Erbfolge nach BGB nicht erbberechtigt, da sie mit dem Erblasser nicht blutsverwandt sind. Ebenfalls nicht erbberechtigt ist der nicht mit dem Erblasser verheiratete oder nicht eingetragene Lebenspartner, selbst wenn das Paar seit Jahren zusammenwohnt oder verlobt ist.
Allerdings kann ein Erblasser auch nicht erbberechtigte Personen, wie den nicht mit ihm verheirateten Lebenspartner oder Freunde, per Testament oder Erbvertrag als Erben einsetzen. Damit lässt sich die gesetzliche Erbfolge mit Ausnahme eines sogenannten Pflichtteils, der unter anderem dem Ehepartner, den Kindern und unter Umständen den Eltern zusteht, umgehen.
Gesetzliche Erbfolge: Blutsverwandte
Für die gesetzliche Erbfolge werden die Blutsverwandten in sogenannte Ordnungen aufgeteilt. Dies dient dazu, die Reihenfolge der Verwandten festzulegen, die – neben einem eventuell vorhandenen Ehepartner – im Todesfall berücksichtigt werden. So soll gewährleistet werden, dass zunächst die nächsten Angehörigen erben und weiter entfernte Verwandte nur dann zum Zug kommen, wenn es keine näheren Verwandten mehr gibt.
Es gibt nach §§ 1924 bis 1929 BGB folgende Ordnungen:
- 1. Ordnung: leibliche und adoptierte Kinder, Enkel und Urenkel des Erblassers und deren weitere Nachkommen,
- 2. Ordnung: Eltern des Erblassers sowie deren Nachkommen wie Geschwister, Nichten, Neffen und Großnichten/-neffen,
- 3. Ordnung: Großeltern des Erblassers sowie deren Nachkommen wie Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen und deren Kinder,
- 4. Ordnung: Urgroßeltern des Erblassers sowie deren Nachkommen, also Großonkel, Großtanten und deren Kinder,
- fernere Ordnungen: alle weiteren Vorfahren wie Ururgroßeltern und sowie weitere entferntere Vorfahren und deren Nachkommen des Erblassers, solange eine Verwandtschaft nachweisbar ist.
Ein Verwandter höherer Ordnung schließt alle nachfolgenden aus
Zuerst erben die nächsten Verwandten der höchsten, nämlich der 1. Ordnung, sowie der Ehepartner des Erblassers. Gibt es keine Personen der 1. Ordnung, erben der Ehepartner sowie die nächsten Verwandten 2. Ordnung.
Grundsätzlich gilt: Ein Verwandter einer höheren Ordnung schließt alle nachfolgenden Ordnungen aus. Das heiß, gibt es Verwandte der 1. Ordnung, erben alle Personen ab der 2. Ordnung nicht mehr. Beispiel: Hat der Erblasser ein Kind, erben die Eltern des Erblassers nicht.
Es erben innerhalb einer Ordnung immer die nächsten Verwandten des Erblassers. Erst wenn ein nächster Verwandter verstorben ist, erbt dessen Nachkomme. Sind beispielsweise die Eltern eines ledigen und kinderlosen Erblassers verstorben, erben die Geschwister des Erblassers. Lebt ein Geschwister nicht mehr, erbt dessen Kind – also der Neffe oder die Nichte des Erblassers – den Erbanteil, der dem Geschwister des Erblassers zugestanden hätte.
Gesetzliche Erbfolge: Ehepartner des Erblassers
Der Ehepartner ist gesetzlicher Erbe neben den Verwandten der 1. oder der 2. Ordnung oder den noch lebenden Großeltern. Der Anteil richtet sich nach dem bestehenden Güterstand.
In der Zugewinngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) erhält der überlebende Ehegatte gemäß § 1931 BGB ein Viertel sowie in Verbindung mit § 1371 BGB ein weiteres Viertel als Zugewinnausgleich – also insgesamt die Hälfte des Nachlasses –, wenn Kinder oder deren Nachfahren vorhanden sind. Die Kinder erhalten insgesamt die andere Hälfte. Dieser Anteil wird in gleichen Teilen auf die Anzahl der Kinder aufgeteilt.
Kinderlose Ehepaare in der Zugewinngemeinschaft
Bei kinderlosen Ehepaaren in der Zugewinngemeinschaft stehen dem hinterbliebenen Ehepartner insgesamt drei Viertel des Nachlasses zu, wenn noch Verwandte der 2. Ordnung, also Eltern des Erblassers oder deren Nachkommen, vorhanden sind oder wenn noch die Großeltern des Erblassers leben. Nachfolgend zwei Beispiele:
- Ehepaar mit Kindern: Stirbt ein Elternteil, erbt der Ehepartner bei Zugewinngemeinschaft die Hälfte des Nachlasses und die Kinder zusammen die andere Hälfte. Hat der Erblasser zwei Kinder, erhält somit jedes Kind ein Viertel des Nachlasses.
- Ehepaar ohne Kinder: Neben dem überlebenden Ehegatten, der bei einer Zugewinngemeinschaft drei Viertel des Nachlasses erbt, erhalten die Eltern oder, sollten diese nicht mehr leben, die Geschwister des Erblassers das übrige Viertel.
Alleinerbe wird der hinterbliebene Ehepartner ohne Testament oder Erbvertrag nur, wenn vom Verstorbenen keine Verwandten der 1. und 2. Ordnung sowie keine Großeltern mehr vorhanden sind. Hinweis: Eingetragene Lebenspartner nach dem LPartG werden wie Ehepartner behandelt.
Erbrecht bei Gütertrennung oder Gütergemeinschaft
Bei Gütertrennung und wenn der Erblasser ein oder zwei Kinder hatte, erben der Ehegatte und die Kinder zu gleichen Teilen. Bei mehr Kindern erbt der Ehepartner ein Viertel des Nachlasses und alle Kinder (oder deren Nachkommen) insgesamt drei Viertel, was sich wiederum auf die Anzahl der Kinder aufteilt.
Bei der Gütergemeinschaft bleibt dem Ehepartner die Hälfte des gemeinsamen Vermögens, sofern im Ehevertrag nichts anderes bestimmt wurde. Der Rest, und was dem Verstorbenen allein gehört hat, ist der Nachlass. Aus diesem Nachlass erhält der Ehepartner ein Viertel und die Kinder des Erblassers oder deren Nachkommen (Personen der 1. Ordnung) insgesamt drei Viertel. Dieser Anteil wird aufgeteilt auf die Anzahl Kinder des Erblassers.
Ist der Erblasser kinderlos, erbt der überlebende Ehegatte nach § 1931 BGB die Hälfte des Nachlasses, die andere Hälfte geht an die Verwandten der 2. Ordnung oder an die Großeltern – unabhängig davon, ob Gütertrennung oder Gütergemeinschaft bestand.
Alleinerbe wird, wie bei der Zugewinngemeinschaft, der hinterbliebene Ehepartner ohne Testament oder Erbvertrag nur, wenn vom Verstorbenen keine Verwandten der 1. und 2. Ordnung sowie keine Großeltern mehr vorhanden sind.
Kinder: ehelich, nichtehelich, adoptiert
Eheliche und nichteheliche Kinder sind gleichgestellt, sofern der Erbfall ab dem 1. April 1998 – dem Inkrafttreten einer entsprechenden Regelung des Gesetzes zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder – eingetreten ist. Damit haben uneheliche leibliche Kinder eines Erblassers den gleichen gesetzlichen Erbanspruch wie eheliche leibliche Kinder.
Adoptivkinder sind leiblichen Kindern gleichgestellt, sofern die Adoption als Minderjähriger nach deutschem Recht erfolgte.
Stiefkinder, also leibliche Kinder eines Ehepartners, aber nicht leibliche Kinder des anderen Ehepartners, der auch Erblasser ist, erben nur, wenn sie vom Erblasser adoptiert wurden. Eine reine Namensänderung (Einbenennung) des Stiefkindes auf den Nachnamen des Ehepartners des leiblichen Elternteils reicht nicht für eine gesetzliche Erbfolge. Auch Pflegekinder haben keinen Erbanspruch.
Von mehreren Erben bis hin zur Erbausschlagung
Gibt es mehrere Erben, bilden sie eine Erbengemeinschaft. Eine Erbengemeinschaft bedeutet, dass alle Erben gemeinsam Eigentümer des gesamten Nachlasses werden. Entscheidungen über die Verwaltung oder Verteilung des Nachlasses können daher nur gemeinsam getroffen werden, was häufig zu Abstimmungsbedarf oder Konflikten führt.
Das Vermögen des Erblassers geht anteilig je nach gesetzlicher Erbfolge auf die Erben über, einschließlich aller Rechte und Pflichten. Letzteres bedeutet, dass nicht nur Guthaben, Immobilien oder Wertgegenstände, sondern in der Regel auch alle Verbindlichkeiten wie Schulden, Kredite oder offene Rechnungen auf die Erben übergehen.
Erben können gemäß den §§ 1942 bis 1966 BGB die Erbschaft auch ausschlagen. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Schulden des Erblassers höher sind als der Wert seines sonstigen Nachlasses.
Die Ausschlagung muss innerhalb von sechs Wochen nach Kenntnis des Erbfalls und der Erbenstellung beim zuständigen Nachlassgericht erklärt werden. Lebte der Erblasser im Ausland oder befindet sich der Erbe im Ausland, beträgt die Frist sechs Monate. Die Erklärung muss persönlich oder öffentlich beglaubigt gegenüber einem Nachlassgericht erfolgen und ist in der Regel unwiderruflich.
Wenn der Erblasser im Ausland wohnt
Wenn der Erblasser oder der Erbe dauerhaft im EU-Ausland wohnt, richtet sich das maßgebliche Erbrecht in den meisten Fällen nach der sogenannten EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO), die seit dem 17. August 2015 für alle EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark und Irland gilt. Demnach gilt das nationale Erbrecht des Landes, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte – unabhängig von dessen Staatsangehörigkeit.
Zum Beispiel: Bei einem deutschen Staatsbürger, der zuletzt in Italien lebte, wird der Nachlass in der Regel nach italienischem Erbrecht abgewickelt. Der Erblasser kann per Testament jedoch auch das Erbrecht des Landes seiner Staatsangehörigkeit wählen. Diese Rechtswahl muss ausdrücklich im Testament oder Erbvertrag festgelegt werden und gilt dann für den gesamten Nachlass.
Außerhalb der EU oder in Ländern mit eigenen Regelungen kann weiterhin das Recht des Landes, dessen Staatsangehörigkeit der Erblasser hat, relevant sein. Bei vererbten Immobilien kann es zudem sein, dass das jeweilige nationale Recht des Landes, in dem die Immobilie liegt, Vorrang hat.
Grenzüberschreitende Konstellationen
Normalerweise ist das Gericht des Landes zuständig, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei grenzüberschreitenden Konstellationen – also wenn der Erblasser im Ausland wohnt oder ausländische Staatsangehöriger ist oder Immobilien im Ausland hat – empfiehlt sich eine Rechtswahl im Testament oder Erbvertrag. Der Erblasser kann so festlegen, welches nationale Erbrecht für seinen Nachlass gelten soll.
Tipp: Ausführliche Informationen zur gesetzlichen Erbfolge bietet die Broschüre „Erben und Vererben“ und für Erben mit Auslandsbezug die Broschüre „Die Europäische Erbrechtsverordnung“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.