Das Erbe: Der Pflichtteil kann nur selten verwehrt werden
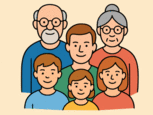 1.9.2025 (€) – Bestimmte Angehörige, die im Testament oder Erbvertrag nicht erwähnt oder sogar vom Erbe ausgeschlossen wurden, können trotzdem Anspruch auf einen Pflichtteil haben. Welche Regelungen hierzu gelten. (Bild: Pixabay CC0)
1.9.2025 (€) – Bestimmte Angehörige, die im Testament oder Erbvertrag nicht erwähnt oder sogar vom Erbe ausgeschlossen wurden, können trotzdem Anspruch auf einen Pflichtteil haben. Welche Regelungen hierzu gelten. (Bild: Pixabay CC0)
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:
Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.
Möchten Sie Artikel ohne Registrierung abrufen, so können Sie jeden Text über GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH einzeln für einen geringen Stückpreis erhalten. Direkt auf diesen Artikel bei Genios gelangen Sie hier.















