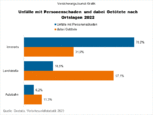KI bei Vermittlern – ja, dürfen die das denn?
 5.9.2023 (€) – Künstliche Intelligenz kann den Vertrieb unterstützen und Routinearbeiten abnehmen, auch im einzelnen Vermittlerunternehmen. Welche Regeln dabei zu beachten sind, wie der KI-Einsatz geprobt wird, und dass man immer einen Plan B haben muss, beschreibt Christian Nölke von Adesso. (Bild: Adesso)
5.9.2023 (€) – Künstliche Intelligenz kann den Vertrieb unterstützen und Routinearbeiten abnehmen, auch im einzelnen Vermittlerunternehmen. Welche Regeln dabei zu beachten sind, wie der KI-Einsatz geprobt wird, und dass man immer einen Plan B haben muss, beschreibt Christian Nölke von Adesso. (Bild: Adesso)
Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.
Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:
Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.
Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.
Möchten Sie Artikel ohne Registrierung abrufen, so können Sie jeden Text über GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH einzeln für einen geringen Stückpreis erhalten. Direkt auf diesen Artikel bei Genios gelangen Sie hier.