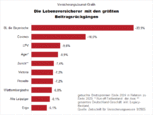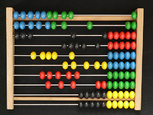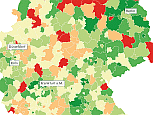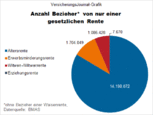3.11.2025 – Detlef Tauscher berichtet im VersicherungsJournal-Extrablatt aus der Praxis: Der Versicherungsmakler altert mit seinen Mandanten, die er seit knapp zwei Jahrzehnten rund um deren Finanzfragen begleitet. Er gewinnt mit ihnen aber auch neue Interessenten, in deren Versicherungsordnern er teilweise skurrile Funde macht. (Bild: Centberg)
mehr ...

27.10.2025 – Vermögen übertragen, für den Pflegefall vorsorgen, Hinterbliebene absichern: Der Versicherungsbedarf der sogenannten Babyboomer betrifft große Lebensfragen. Warum diese Zielgruppe für Vermittler interessant ist, zeigt das VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025. (Bild: VersicherungsJournal)
mehr ...

27.10.2025 – Rendite, Sicherheit, Flexibilität: Nicht selten widersprechen sich die Wünsche der Kunden für ihre Finanzen im Alter. Wie Berater entscheidend bei einem klaren Fahrplan für eine abgesicherte Zukunft helfen können, ist Thema das neuen VersicherungsJournal-Extrablatts. (Bild: VersicherungsJournal)
mehr ...

1.10.2025 – Fondspolicen steigen in der Gunst der Versicherungsmakler. Doch noch nicht alle von ihnen kennen auch die Steuervorteile der Produkte, wenn Vermögen übertragen wird. Mit bestimmten Tarifen beschäftigen sich manche Vermittler vermehrt auch, um ihren eigenen Ruhestand zu planen. (Bild: Pixabay CC0)
mehr ...

12.6.2025 – Aufgrund ihrer Steuervorteile kann eine Fondspolice im Vergleich mit einem direkten Investment die bessere Wahl sein. Aber geht diese Rechnung auch dann noch auf, wenn man einen ETF-Sparplan oder eine Nettopolice wählt und einen Auszahlplan bis 85 mit einer Leibrente kombiniert? (Bild: IVFP)
mehr ...

10.6.2025 – Fondsgebundene Versicherungen stehen häufig wegen ihrer Abschlusskosten in der Kritik. Im Vergleich zu Direktinvestments in Fonds bieten sie aber steuerliche Vorteile. Ein Blick auf die Details zeigt, in welchen Fällen die Produktalternativen die bessere Wahl sind. (Bild: IVFP)
mehr ...

29.9.2020 – Für einige Berufsgruppen wird es in der Risiko-Lebensversicherung und in der Berufsunfähigkeits-Versicherung wieder günstiger. Der Volkswohl Bund, die Bayerische und die Basler haben die Berufsklassen neu strukturiert. Neuigkeiten gibt es auch von der VPV. (Bild: Pixabay CC0)
mehr ...
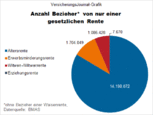
19.5.2020 – Auch die letzte Erhöhung war für viele Versicherte nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vielfach kommt es auf die Art der Leistung und das Geschlecht an. Das zeigt die aktuelle Rentenbestandsstatistik. (Bild: Zwick)
mehr ...
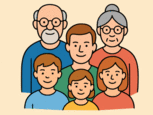 8.9.2025 (€) – Die Familienkonstellation hat beim Erben große Auswirkungen. Besonders deutlich wird das bei Stief- und Patchworkfamilien. Denn ohne klare Regelungen führt die gesetzliche Erbfolge oft zu überraschenden und für den Erblasser oft auch unerwünschten Ergebnissen. (Bild: Pixabay CC0)
8.9.2025 (€) – Die Familienkonstellation hat beim Erben große Auswirkungen. Besonders deutlich wird das bei Stief- und Patchworkfamilien. Denn ohne klare Regelungen führt die gesetzliche Erbfolge oft zu überraschenden und für den Erblasser oft auch unerwünschten Ergebnissen. (Bild: Pixabay CC0)